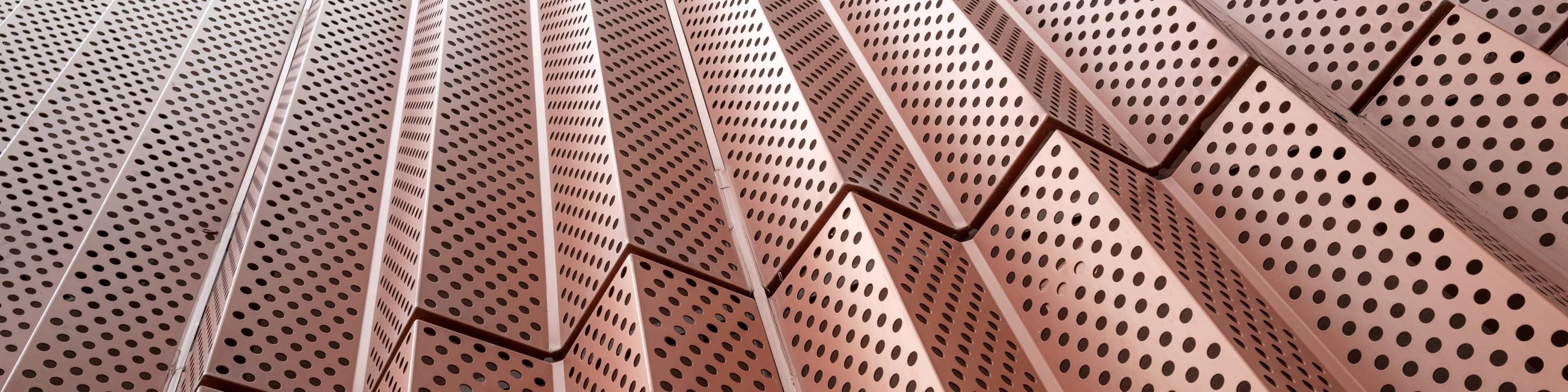Am 7. Juli 2025 wurde endlich der Gesetzentwurf zur Klarstellung der Beurteilung von Arbeitsverhältnissen und der Rechtsvermutung („VBAR“) eingereicht. Dieser Gesetzentwurf wurde schon seit längerer Zeit erwartet und sollte vor der Sommerpause im Unterhaus eingebracht werden. Das geplante Datum des Inkrafttretens ist der 1. Juli 2026, aber dies muss natürlich auch umsetzbar sein. Angesichts der bevorstehenden Wahlen bleibt abzuwarten, ob dies tatsächlich gelingen wird.
Warum dieser Gesetzentwurf?
Die Diskussion um Selbstständige wird den meisten nicht entgangen sein. Seit der Einführung des Gesetzes zur Deregulierung der Beurteilung von Arbeitsverhältnissen („Wet DBA“) besteht Unklarheit über dessen Umsetzung, und in diesem Zusammenhang wurde die Durchsetzung ausgesetzt (Durchsetzungsmoratorium). Zum 1. Januar 2025 wird dieses Durchsetzungsmoratorium aufgehoben und die Einhaltung des Gesetzes grundsätzlich aktiv durchgesetzt. Das bedeutet, dass die Steuerbehörde für den Zeitraum bis zum 1. Januar 2025 Prüfungen und Korrekturen vornehmen können, wenn sie der Meinung sind, dass ein Arbeitsverhältnis vorliegt. Im Jahr 2025 werden übrigens noch keine Bußgelder verhängt. Es wird also weiterhin keine Korrekturen oder Nachforderungen für die Jahre vor 2025 geben, es sei denn, es liegt Vorsatz vor oder es wurden ausdrückliche Anweisungen der Steuerbehörde nicht befolgt.
Der Gesetzentwurf soll Klarheit darüber schaffen, wann eine Scheinselbstständigkeit vorliegt. Diese kann in allen Segmenten des Arbeitsmarktes auftreten:
- An der Basis des Arbeitsmarktes; in diesem Fall handelt es sich meist um erzwungene Scheinselbstständigkeit. Der Arbeitnehmer möchte eigentlich in einem Angestelltenverhältnis stehen, aber der Arbeitgeber möchte aus Gründen der Flexibilität und/oder aus Kostengründen mit Selbstständigen zusammenarbeiten.
- In der Mitte und auf der oberen Ebene des Arbeitsmarktes; in diesem Fall ist es meist der Arbeitnehmer, der aus Gründen der Flexibilität und/oder aus steuerlichen Gründen die Arbeit als Selbstständiger bevorzugt, während der Arbeitgeber den Arbeitnehmer möglicherweise einstellen möchte. Dies ist unter anderem in sozialen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, dem Bildungswesen und der Kinderbetreuung der Fall.
Scheinselbstständigkeit kann aus verschiedenen Gründen unerwünscht sein. Aus der Begründung zum Gesetzentwurf gehen folgende Punkte hervor:
- Verletzlichkeit der Arbeitnehmer an der Basis des Arbeitsmarktes;
- Solidarität innerhalb des Sozialsystems. Denken Sie dabei an die geringere Beteiligung an allgemeinen Sozialleistungen wie Gesundheitsversorgung und Altersrente, aber auch an die Bezahlbarkeit von Arbeitslosenunterstützung und Erwerbsunfähigkeitsrente, und Steuervergünstigungen;
- Scheinselbstständigkeit kann als unlautere Form des Wettbewerbs sowohl zwischen Arbeitnehmern als auch zwischen Arbeitgebern angesehen werden;
- Ein höherer Anteil an Scheinselbstständigkeit in einem Unternehmen könnte Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung haben, den Grad der Innovation und die Kontinuität innerhalb des Unternehmens oder der Organisation.
Das oben Gesagte betont die Scheinselbstständigkeit. Echte Selbstständigkeit in ihrer optimalen Form kann hingegen sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber verschiedene Vorteile mit sich bringen. Die Beurteilung der Beziehung bleibt daher immer von entscheidender Bedeutung.
Inhalt des Gesetzentwurfs
Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, Klarheit über das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu schaffen. Die Ausarbeitung des Gesetzentwurfs war ein dynamischer Prozess, bei dem die Rechtsprechung stets berücksichtigt wurde, insbesondere das mittlerweile bekannte Deliveroo-Urteil und das später folgende Uber-Urteil des Oberste Gerichtshof. Der Entwurf enthält zwei Änderungen des Bürgerlichen Gesetzbuches
- Eine Definition, wann ein Arbeitsverhältnis als Angestellter vorliegt. Dies ist der Fall, wenn:
- eine inhaltliche oder organisatorische Steuerung vorliegt und
- die Arbeit nicht auf eigene Rechnung und eigenes Risiko verrichtet wird.
- Eine Vermutungsregel: Bei einer Vergütung von maximal € 36 pro Stunde besteht die Vermutung, dass ein Arbeitsverhältnis vorliegt.
Ohne inhaltliche oder organisatorische Steuerung liegt kein Autoritätsverhältnis und damit auch kein Dienstverhältnis vor. Liegt hingegen eine inhaltliche oder organisatorische Steuerung vor, muss geprüft werden, ob der Arbeitnehmer auf eigene Rechnung und eigenes Risiko arbeitet. Ist dies der Fall, muss geprüft werden, wo der Schwerpunkt liegt. Dies muss im Einzelfall geprüft werden. Das kann bedeuten, dass zwei Personen, die die gleichen Tätigkeiten ausüben, dennoch ein unterschiedliches Rechtsverhältnis zum gleichen Arbeitgeber haben, weil bei der einen Person der Schwerpunkt auf der Ausführung von Arbeiten auf eigene Rechnung und eigenes Risiko liegt, während bei der anderen Person der Schwerpunkt auf der Arbeit auf eigene Rechnung und eigenes Risiko liegt.
Die Auslegung der Begriffe „Anweisung” oder „Ausführung von Tätigkeiten auf eigene Rechnung und Risiko” erfolgt durch eine allgemeine Verwaltungsmaßnahme und ist nicht in diesem Gesetzentwurf enthalten. Es ist zu erwarten, dass diese Begriffe mit dem Deliveroo-Urteil übereinstimmen, das der Oberste Gerichtshof bereits im März 2023 gefällt hat. Aus diesem Urteil geht hervor, dass die Fakten und Umstände von entscheidender Bedeutung sind, um zu beurteilen, ob ein Arbeitsverhältnis vorliegt. Diese Fakten und Umstände sind die folgenden:
- die Art und Dauer der ausgeübten Tätigkeit
- die Art und Weise, wie die Arbeit, aber auch die Arbeitszeiten festgelegt werden
- die „Einbettung” der Arbeit und der Person, die die Tätigkeiten ausübt, in die Organisation und Betriebsführung desjenigen, für den die Arbeit ausgeführt wird
- die Verpflichtung (oder Nichtverpflichtung), die Arbeit persönlich zu verrichten
- die Art und Weise, wie der Vertrag zustande kommt
- die Art und Weise, wie die Vergütung festgelegt und gezahlt wird, sowie die Höhe der Vergütung
- ob die Person, die die Arbeit ausführt, ein wirtschaftliches Risiko trägt oder sich wie ein Unternehmer im Wirtschaftsverkehr verhält (oder verhalten kann).
Im ersten Entwurf des Gesetzentwurfs schien die Ausführung von Arbeit auf eigene Rechnung und eigenes Risiko der inhaltlichen Unterordnung und organisatorischen Einbettung untergeordnet zu sein. Nachdem der Oberste Gerichtshof im Februar 2025 das Uber-Urteil gefällt hatte, wurde der Gesetzentwurf entsprechend angepasst, sodass diese beiden Elemente nun gleichwertig sind.
Übergangsrecht
Mit diesem Gesetzentwurf wird kein Übergangsrecht eingeführt. In der Praxis wird sich hinsichtlich der ersten Änderung wenig ändern, da diese durch die bereits geltende Rechtsprechung bedingt ist. Die Beweismutmaßung für Vergütungen, die € 36 pro Stunde nicht überschreiten, hat ebenfalls unmittelbare Wirkung. Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einen niedrigeren Stundenlohn erhalten, sind dadurch in einer besseren Position, um einen Arbeitsvertrag zu fordern. Dies ist auch der Grund, warum in diesem Punkt kein Übergangsrecht eingeführt wird.
Gesetzesentwurf Selbstständigengesetz
VVD, D66, CDA und SGP haben im April 2025 einen Gesetzesentwurf mit einem Bewertungsrahmen vorgelegt, der festlegen soll, wann jemand als selbstständig gilt. Die Internetkonsultation zu diesem Gesetzentwurf wurde am 23. Juni 2025 abgeschlossen, und der Beratungsausschuss für die Überprüfung der Regulierungslast (ATR) hat am 30. Juni 2025 eine kritische Stellungnahme zu dem Gesetzesentwurf abgegeben. Die Prüfung im Gesetzesentwurf würde neue Unklarheiten schaffen, die Durchführbarkeit ist unklar und die Regulierungslast wurde nicht erfasst. Unklar ist derzeit, wie die nächsten Schritte für diesen Gesetzesentwurf aussehen und welche Zeitpläne damit verbunden sind, insbesondere im Zusammenhang mit dem jetzt vorgelegten Gesetzesentwurf VBAR.
Schlussfolgerung und Praxis
Der lang erwartete Gesetzentwurf VBAR enthält keine überraschenden Elemente. Die Rechtsvermutung von € 36 pro Stunde war bereits angekündigt worden, und im Übrigen handelt es sich bei dem Entwurf um eine Kodifizierung der bereits bestehenden Rechtsprechung. In der Praxis wird insbesondere die Rechtsvermutung noch zu Anpassungen in den Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern führen können, aber wir gehen davon aus, dass der Stundenlohn von € 36 in der Praxis bei der Festlegung des für die Arbeiten vereinbarten Stundensatzes berücksichtigt wird. Was aus dem Gesetzesentwurf zum Selbstständigen-Gesetz werden wird, ist noch ungewiss.
Selbstverständlich werden wir Sie über neue Entwicklungen in diesem Bereich auf dem Laufenden halten. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Beziehung zu Selbstständigen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren RSM-Berater. Diese können die betreffende Beziehung für Sie beurteilen und Ihnen bei eventuellen weiteren Schritten helfen.